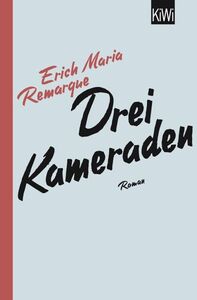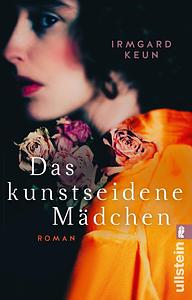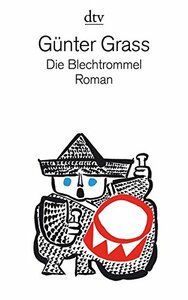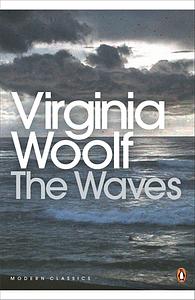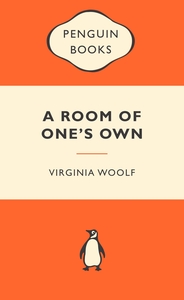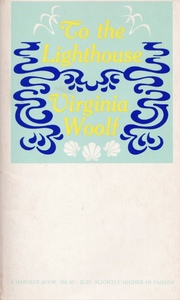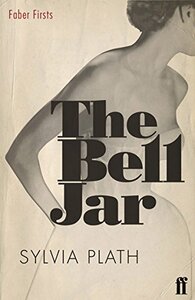Take a photo of a barcode or cover
pascalthehoff's reviews
404 reviews
Was mich an Bahnwärter Thiel am meisten beeindruckt hat, ist die Ehrfurcht, mit der es damals neue Technologien beschreibt. Ein vorbeifahrender Zug gleicht in dieser Geschichte einer Naturgewalt. Vom langsamen dramaturgischen Aufbau bis zur erschütternden Präsenz der Maschine schmücken starke Bilder und Eindrücke dieses Ereignis, das uns mehr als 100 Jahre später alltäglich erscheint. Auf die Szene, die den Zug am stärksten in Szene setzt folgt eine, in der ein furchtbares Gewitter anrollt. Zug und Gewitter werden stilistisch auf nahezu identische Weise beschrieben. Deutlich wird so nicht nur, welch eine monumentale Erfindung die Bahn damals war, sondern auch mit welch ungeheurer Energie wir heute täglich zu Millionen durchs Land düsen.
Das Familiendrama, das ja der eigentliche Mittelpunkt der Handlung ist, wirkt aus heutiger Sicht weniger fesselnd und herausragend. Schließlich haben wir in der literarischen Darstellung häuslicher Rollenverhältnisse und Gewalt wahnsinnige Fortschritte gemacht, die oft genug zu einer deutlich nuancierteren Repräsentation führen. Zu diesem literarischen Diskurs kann Bahnwärter Thiel auch mit seiner historischen Perspektive nicht allzu viel hinzufügen. Also ist die Novelle in diesem Aspekt tatsächlich in erster Linie aufgrund ihrer Historizität faszinierend.
Das Familiendrama, das ja der eigentliche Mittelpunkt der Handlung ist, wirkt aus heutiger Sicht weniger fesselnd und herausragend. Schließlich haben wir in der literarischen Darstellung häuslicher Rollenverhältnisse und Gewalt wahnsinnige Fortschritte gemacht, die oft genug zu einer deutlich nuancierteren Repräsentation führen. Zu diesem literarischen Diskurs kann Bahnwärter Thiel auch mit seiner historischen Perspektive nicht allzu viel hinzufügen. Also ist die Novelle in diesem Aspekt tatsächlich in erster Linie aufgrund ihrer Historizität faszinierend.
Beim Titel "Drei Kameraden" hätte ich nicht erwartet, dass die einzelnen Charaktere – bis auf den Protagonisten und die "vierte Kameradin" Pat – so austauschbar wären. Star der Erzählung sind also weniger die Drei Kameraden als das turbulente deutsche Großstadtleben Ende der 1920er. Denn sogar die zentrale Liebesgeschichte faszinierte mich nicht annähernd so sehr wie der einfache Alltag der zahlreichen Figuren, bis in die kleinsten Nebencharaktere.
Mehr als einzelne Elemente glänzt Drei Kameraden also als Gesamtwerk. Das macht es mitunter langwierig, doch trägt der grandiose Stil die gesamte Erzählung. Die simple Umgangssprache ist voller Leben, vermittelt Geschehen und Gedanken aber gleichzeitig präzise, intelligent und eindrucksstark. Ein Spagat, der nur wenigen Romane so breit gespreizt gelingt:
"»Das verstehst du nicht«, erwiderte Lenz, »du kommerzieller Sohn des zwanzigsten Jahrhunderts.« Ferdinand Grau lachte. Fred auch. Schließlich lachten wir alle. Wenn man über das zwanzigste Jahrhundert nicht lachte, musste man sich erschießen. Aber man konnte nicht lange darüber lachen. Es war ja eigentlich zum Heulen."
"Sieh dir die Zigarre an! Eine Mark fünfzig das Stück. Du hast mir einen Milliardär verjagt.« Gottfried nahm mir die Zigarre aus der Hand, beroch sie und zündete sie sich an. »Ich habe dir einen Schwindler verjagt. Milliardäre rauchen nicht solche Zigarren. Die rauchen welche zu einem Groschen das Stück.«"
"Der Schmied nahm uns noch eine Sekunde beiseite. »Hört mal zu«, sagte er, »wenn ihr mal jemand zu verhauen habt – ich wohne Leibnizstraße sechzehn, Hinterhof, zwei Treppen links. Eventuell, wenn’s mehrere sind, komme ich auch mit meinem Verein.«"
Die gesammelte untere Gesellschaftsschicht demonstriert in der Welt des Romans – trotz immer wieder auftretender Konflikte – einen Zusammenhalt und eine persönliche Nähe, bei der sich das Leben 100 Jahre später ganz kalt und entfremdet anfühlt. Ob es diesen Klassenzusammenhalt nun romantisiert oder nicht, beweist Drei Kameraden ein tiefes Verständnis der sozialen Missstände und der sich anbahnenden Konflikte im Deutschland zwischen den Kriegen. Und das ganz ohne den Segen, diese Zeit gemütlich aus der Nachkriegslinse betrachten zu können. Schließlich wurde Drei Kameraden mitten in dieser turbulenten Zeit verfasst und veröffentlicht. Das könnte auch der Grund dafür sein, dass der Roman das Geschehen so natürlich und subtil darstellt, statt zum Beispiel die bevorstehende Nazibedrohung zu überspitzen.
Bonuspunkte gibt es für die unzähligen Kneipenszenen, die – ungelogen – alle paar Seiten auftauchen. Wunderbarer proletarischer Galgenhumor, wie man ihn dann eben doch selten in "großer Literatur" sieht:
"Für sehr schwierige Gäste hatte er einen Hammer unter der Theke bereit. Das Lokal lag praktisch; dicht beim Krankenhaus. Alfons sparte so die Transportkosten."
"»Bier?«, fragte er. »Korn und was zu essen«, sagte ich. »Und die Dame?«, fragte Alfons. »Die Dame will auch einen Korn«, sagte Patrice Hollmann. »Heftig, heftig«, meinte Alfons."
Wenn ich also eins aus Drei Kameraden mitnehme, dann, dass ich "Heftig, heftig" in meinen Alltagswortschatz aufnehmen sollte.
Mehr als einzelne Elemente glänzt Drei Kameraden also als Gesamtwerk. Das macht es mitunter langwierig, doch trägt der grandiose Stil die gesamte Erzählung. Die simple Umgangssprache ist voller Leben, vermittelt Geschehen und Gedanken aber gleichzeitig präzise, intelligent und eindrucksstark. Ein Spagat, der nur wenigen Romane so breit gespreizt gelingt:
"»Das verstehst du nicht«, erwiderte Lenz, »du kommerzieller Sohn des zwanzigsten Jahrhunderts.« Ferdinand Grau lachte. Fred auch. Schließlich lachten wir alle. Wenn man über das zwanzigste Jahrhundert nicht lachte, musste man sich erschießen. Aber man konnte nicht lange darüber lachen. Es war ja eigentlich zum Heulen."
"Sieh dir die Zigarre an! Eine Mark fünfzig das Stück. Du hast mir einen Milliardär verjagt.« Gottfried nahm mir die Zigarre aus der Hand, beroch sie und zündete sie sich an. »Ich habe dir einen Schwindler verjagt. Milliardäre rauchen nicht solche Zigarren. Die rauchen welche zu einem Groschen das Stück.«"
"Der Schmied nahm uns noch eine Sekunde beiseite. »Hört mal zu«, sagte er, »wenn ihr mal jemand zu verhauen habt – ich wohne Leibnizstraße sechzehn, Hinterhof, zwei Treppen links. Eventuell, wenn’s mehrere sind, komme ich auch mit meinem Verein.«"
Die gesammelte untere Gesellschaftsschicht demonstriert in der Welt des Romans – trotz immer wieder auftretender Konflikte – einen Zusammenhalt und eine persönliche Nähe, bei der sich das Leben 100 Jahre später ganz kalt und entfremdet anfühlt. Ob es diesen Klassenzusammenhalt nun romantisiert oder nicht, beweist Drei Kameraden ein tiefes Verständnis der sozialen Missstände und der sich anbahnenden Konflikte im Deutschland zwischen den Kriegen. Und das ganz ohne den Segen, diese Zeit gemütlich aus der Nachkriegslinse betrachten zu können. Schließlich wurde Drei Kameraden mitten in dieser turbulenten Zeit verfasst und veröffentlicht. Das könnte auch der Grund dafür sein, dass der Roman das Geschehen so natürlich und subtil darstellt, statt zum Beispiel die bevorstehende Nazibedrohung zu überspitzen.
Bonuspunkte gibt es für die unzähligen Kneipenszenen, die – ungelogen – alle paar Seiten auftauchen. Wunderbarer proletarischer Galgenhumor, wie man ihn dann eben doch selten in "großer Literatur" sieht:
"Für sehr schwierige Gäste hatte er einen Hammer unter der Theke bereit. Das Lokal lag praktisch; dicht beim Krankenhaus. Alfons sparte so die Transportkosten."
"»Bier?«, fragte er. »Korn und was zu essen«, sagte ich. »Und die Dame?«, fragte Alfons. »Die Dame will auch einen Korn«, sagte Patrice Hollmann. »Heftig, heftig«, meinte Alfons."
Wenn ich also eins aus Drei Kameraden mitnehme, dann, dass ich "Heftig, heftig" in meinen Alltagswortschatz aufnehmen sollte.
In der Weimarer Republik waren die deutsche Gesellschaft, Wirtschaft und Infrastruktur noch nicht bereit für den American Dream – die Leute in den Metropolen taten aber trotzdem so. Für die Protagonistin Doris heißt es also: fake it til you make it, basierend auf Halbwissen und verklärten Idealen, die aus den USA über den Atlantik geschwappt sind.
Doris erkennt, dass sie in einer Klassengesellschaft lebt und macht den Aufstieg durch Glanz und Glitter zu ihrem einzigen Lebensinhalt. Trotz dieses Klassenbewusstseins äußert sie den Wunsch, lieber "Lieder ohne Politik" zu singen. 2022 wäre das ein typischer Gedanke für Leute, die einen autonomen Aufstieg nach amerikanischem Ideal anstreben: "Nicht die Politik bringt mir den Wohlstand, ich muss ihn mir selbst verdienen!"
In den frühen 1930ern jedoch – eine Zeit, die wir heute als hoch politisiert betrachten – wirkt diese bewusste Abkehr von der Politik ungewöhnlich. Jeder Roman aus der Zukunft ÜBER diese Epoche würde das Setting politisch aufladen. Das kunstseidene Mädchen jedoch umtanzt sogar das Thema NSDAP, bis auf wenige Seitenhiebe, die unaufdringlich, aber unmissverständlich Stellung beziehen. Ein authentischer Zeitzeugenblick auf diese Zeit aus einer vergleichsweise unverbrauchten Perspektive!
Wenn Doris sagt „Ich habe mir einen Schwur gemacht: Dass ich nicht eine sein will, die man auslacht, sondern die selber auslacht“, spricht da der Stolz auf eigene Leistung, aber auch die toxische Verachtung gegenüber der Klasse, aus der sie sich zu erheben versucht. Doris erkennt, wie schwierig es für sie ist, zwischen Armut und Sexismus höhere Bildung zu erlangen. Sie ignoriert aber die systemischen Probleme dahinter, was wunderbar ein Problem widerspiegelt, das uns 100 Jahre später gefühlt mehr denn je verfolgt.
In seinem Umgang mit Männern liest sich Das kunstseidene Mädchen zuweilen wie ein Historienroman, der kurz nach der ersten MeToo-Welle verfasst wurde. Der unmittelbare Zeitzeugencharakter macht den Roman demnach umso faszinierender, wenn wir auf ihn zurückblicken.
Während Das kunstseidene Mädchen eine kritische Haltung zur Rolle und zum Verhalten des typischen Mannes in der Gesellschaft einnimmt, zeigt der Roman gleichzeitig, wie unabdingbar es damals war, sich als ambitionierte Frau mit einflussreichen Männern gut zu stellen. Ein Ritt auf Messers Schneide, um die Privilegien der Männer für sich selbst auszuspielen.
Die Gender-Rollen im Kopf der Protagonistin sind weitgehend starr; das sollte im Kontext der Zeit aber auch nicht überraschen. Dennoch nimmt die Frage, ob Doris sich an einen Mann binden will oder nicht, einen großen Teil ihres inneren Konflikts ein: Einerseits möchte sie eben nicht diesem typischen, im Haushalt gefangenen Frauenbild entsprechen. Andererseits spürt sie, wie verlockend es ist, diese Abkürzung aus ihrem gescheiterten Karriereversuch zu nehmen, als die Chance an ihre Tür klopft.
Was Das kunstseidene Mädchen für mich besonders herausragend macht, ist die (aus heutiger Sicht) seltsam vornehme Jugendsprache, die es verwendet. Sie verleiht dem Roman eine ganz eigene Tonalität, die kreative Kaltschnäuzigkeit mit der konservativen Höflichkeit prä-moderner Literatur vermischt. Literarisch ansprechend und gleichzeitig ein riesiger Spaß mit ganz eigenen witzigen Floskeln und Beleidigungen, die wir heute gar nicht mehr verwenden und man fragt sich: Wieso eigentlich nicht? Den Gegenpol bildet die melancholische Einsamkeit der Großstadt, die der Roman auf eine sehr verletzliche, moderne Art einfängt. Beide Extreme greifen organisch ineinander und wirken stets wie aus einem Guss.
Doris erkennt, dass sie in einer Klassengesellschaft lebt und macht den Aufstieg durch Glanz und Glitter zu ihrem einzigen Lebensinhalt. Trotz dieses Klassenbewusstseins äußert sie den Wunsch, lieber "Lieder ohne Politik" zu singen. 2022 wäre das ein typischer Gedanke für Leute, die einen autonomen Aufstieg nach amerikanischem Ideal anstreben: "Nicht die Politik bringt mir den Wohlstand, ich muss ihn mir selbst verdienen!"
In den frühen 1930ern jedoch – eine Zeit, die wir heute als hoch politisiert betrachten – wirkt diese bewusste Abkehr von der Politik ungewöhnlich. Jeder Roman aus der Zukunft ÜBER diese Epoche würde das Setting politisch aufladen. Das kunstseidene Mädchen jedoch umtanzt sogar das Thema NSDAP, bis auf wenige Seitenhiebe, die unaufdringlich, aber unmissverständlich Stellung beziehen. Ein authentischer Zeitzeugenblick auf diese Zeit aus einer vergleichsweise unverbrauchten Perspektive!
Wenn Doris sagt „Ich habe mir einen Schwur gemacht: Dass ich nicht eine sein will, die man auslacht, sondern die selber auslacht“, spricht da der Stolz auf eigene Leistung, aber auch die toxische Verachtung gegenüber der Klasse, aus der sie sich zu erheben versucht. Doris erkennt, wie schwierig es für sie ist, zwischen Armut und Sexismus höhere Bildung zu erlangen. Sie ignoriert aber die systemischen Probleme dahinter, was wunderbar ein Problem widerspiegelt, das uns 100 Jahre später gefühlt mehr denn je verfolgt.
In seinem Umgang mit Männern liest sich Das kunstseidene Mädchen zuweilen wie ein Historienroman, der kurz nach der ersten MeToo-Welle verfasst wurde. Der unmittelbare Zeitzeugencharakter macht den Roman demnach umso faszinierender, wenn wir auf ihn zurückblicken.
Während Das kunstseidene Mädchen eine kritische Haltung zur Rolle und zum Verhalten des typischen Mannes in der Gesellschaft einnimmt, zeigt der Roman gleichzeitig, wie unabdingbar es damals war, sich als ambitionierte Frau mit einflussreichen Männern gut zu stellen. Ein Ritt auf Messers Schneide, um die Privilegien der Männer für sich selbst auszuspielen.
Die Gender-Rollen im Kopf der Protagonistin sind weitgehend starr; das sollte im Kontext der Zeit aber auch nicht überraschen. Dennoch nimmt die Frage, ob Doris sich an einen Mann binden will oder nicht, einen großen Teil ihres inneren Konflikts ein: Einerseits möchte sie eben nicht diesem typischen, im Haushalt gefangenen Frauenbild entsprechen. Andererseits spürt sie, wie verlockend es ist, diese Abkürzung aus ihrem gescheiterten Karriereversuch zu nehmen, als die Chance an ihre Tür klopft.
Was Das kunstseidene Mädchen für mich besonders herausragend macht, ist die (aus heutiger Sicht) seltsam vornehme Jugendsprache, die es verwendet. Sie verleiht dem Roman eine ganz eigene Tonalität, die kreative Kaltschnäuzigkeit mit der konservativen Höflichkeit prä-moderner Literatur vermischt. Literarisch ansprechend und gleichzeitig ein riesiger Spaß mit ganz eigenen witzigen Floskeln und Beleidigungen, die wir heute gar nicht mehr verwenden und man fragt sich: Wieso eigentlich nicht? Den Gegenpol bildet die melancholische Einsamkeit der Großstadt, die der Roman auf eine sehr verletzliche, moderne Art einfängt. Beide Extreme greifen organisch ineinander und wirken stets wie aus einem Guss.
Die weirdeste Coming-of-Age-Geschichte, die ihr je lesen werdet. Mal langwierig, mal aktiv belastend, ist die Blechtrommel im schlimmsten Fall ein faszinierendes Zeitzeugnis. Die meiste Zeit jedoch bleibt der Roman – trotz seiner enormen Länge – kreativ, unvorhersehbar, sprachlich einzigartig und auch Jahrzehnte später immer noch urkomisch in seinem "Einfache-Leute"-Gossenhumor. (Sofern man einige der fragwürdigeren "Witze" als Relikt ihrer Zeit ignorieren kann.)
Anders, als ich es erwartet hätte, behandelt die Blechtrommel das Zeitgeschehen der Epochen, in denen sie spielt, nur anekdotisch. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nur, weil Grass nirgends FCK NZS schreibt, heißt dies aber nicht, dass seine trocken-sachliche Beschreibung von Nazis und anderem Gesocks diese Charaktere nicht umso schärfer verurteilt... wenn solche Charaktere denn überhaupt auftauchen.
Die meiste Zeit nämlich zeigt die Blechtrommel das traditionelle mitteleuropäische Alltagsleben, betrachtet durch eine verzerrende, moderne Linse. Der Ich-Erzähler Oskar dient als abgeklärter Beobachter, der das Geschehen um ihn herum dekonstruierend kommentiert und punktuell in unvorhergesehene Richtungen lenkt.
Gemessen an all dem, was Oskar im Leben wiederfährt, durchläuft er praktisch keine signifikante Charakterentwicklung. Er ist ein spitzwinkeliges Werkzeug, das historische Alltagssituationen und ihre vermeintliche Unschuld verzerrt – oft, indem er sie in noch größeres Chaos stürzt. Der Roman baut Szenen aufwendig auf und fragt dann: "Was würde passieren, wenn Oskar jetzt DIESE sehr unerwartete Handlung vollziehen würde?"
Je mehr Zeit ich mit der Blechtrommel verbrachte, desto mehr verzieh ich dem Roman seine Geschwätzigkeit. Gewissermaßen wird es Teil von Oskars Charakter, dass er sich in seiner Selbstabsorption gerne in belanglosen Details verliert. Auch 2022 noch ein einzigartiger Roman.
Anders, als ich es erwartet hätte, behandelt die Blechtrommel das Zeitgeschehen der Epochen, in denen sie spielt, nur anekdotisch. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nur, weil Grass nirgends FCK NZS schreibt, heißt dies aber nicht, dass seine trocken-sachliche Beschreibung von Nazis und anderem Gesocks diese Charaktere nicht umso schärfer verurteilt... wenn solche Charaktere denn überhaupt auftauchen.
Die meiste Zeit nämlich zeigt die Blechtrommel das traditionelle mitteleuropäische Alltagsleben, betrachtet durch eine verzerrende, moderne Linse. Der Ich-Erzähler Oskar dient als abgeklärter Beobachter, der das Geschehen um ihn herum dekonstruierend kommentiert und punktuell in unvorhergesehene Richtungen lenkt.
Gemessen an all dem, was Oskar im Leben wiederfährt, durchläuft er praktisch keine signifikante Charakterentwicklung. Er ist ein spitzwinkeliges Werkzeug, das historische Alltagssituationen und ihre vermeintliche Unschuld verzerrt – oft, indem er sie in noch größeres Chaos stürzt. Der Roman baut Szenen aufwendig auf und fragt dann: "Was würde passieren, wenn Oskar jetzt DIESE sehr unerwartete Handlung vollziehen würde?"
Je mehr Zeit ich mit der Blechtrommel verbrachte, desto mehr verzieh ich dem Roman seine Geschwätzigkeit. Gewissermaßen wird es Teil von Oskars Charakter, dass er sich in seiner Selbstabsorption gerne in belanglosen Details verliert. Auch 2022 noch ein einzigartiger Roman.
The spiritual predecessor to the show Friends.
Jokes aside, of all the Virginia Woolf books I've read, this is my least favorite one. Where novels like Mrs Dalloway and especially To the Lighthouse live from their themes and setting, the very character-centered approach of The Waves didn't work for me, in combination with Woolf's usual very loose (yet still beautiful) prose.
On top of that, this is Woolf's longest novel – and it definitely feels like it. If not for the great audio book version I've listened to, with six different speakers performing what's basically an ASMR play of the novel, I doubt I could have finished this.
I've heard that The Waves was supposed to be Woolf's richest and deepest novel. Maybe the usual tranquil tonality, paired with the calm audio book rendition lulled me to sleep, to a degree where most of the substance went over my head.
Actually, I'd wager I probably missed a lot of the "substance" (whatever that is) in every Virginia Woolf novel I've read or listened to thus far. However, The Waves is the only one where I was unable to appreciate the novel in spite of that. Woolf's fiction is always somewhat intangible, but with The Waves, reading the novel just for the aesthetic beauty of the prose and the imagery wasn't enough for me.
Jokes aside, of all the Virginia Woolf books I've read, this is my least favorite one. Where novels like Mrs Dalloway and especially To the Lighthouse live from their themes and setting, the very character-centered approach of The Waves didn't work for me, in combination with Woolf's usual very loose (yet still beautiful) prose.
On top of that, this is Woolf's longest novel – and it definitely feels like it. If not for the great audio book version I've listened to, with six different speakers performing what's basically an ASMR play of the novel, I doubt I could have finished this.
I've heard that The Waves was supposed to be Woolf's richest and deepest novel. Maybe the usual tranquil tonality, paired with the calm audio book rendition lulled me to sleep, to a degree where most of the substance went over my head.
Actually, I'd wager I probably missed a lot of the "substance" (whatever that is) in every Virginia Woolf novel I've read or listened to thus far. However, The Waves is the only one where I was unable to appreciate the novel in spite of that. Woolf's fiction is always somewhat intangible, but with The Waves, reading the novel just for the aesthetic beauty of the prose and the imagery wasn't enough for me.
If her other works didn't convince you, this narrative essay is proof that Virginia Woolf was way ahead of her time. Not only in terms of feminism, but also when it comes to classist issues, circumstances of the underprivileged and more. Most impressively, there is a part in here that introduces some very modern perspectives on gender theory – about biological sex vs. gender identity (we can never feel all-male or all-female) as well as the "androgynous mind" which straddles the line between being male or female, and is, according to her, the prerequisite for writing lively fiction.
I love how poetical this book is for an essay and how it is modest and scathing at the same time. Basically Virginia Woolf's brand, but with clarity that is (intentionally) absent in her novels.
The first chapter that consisted almost solely of narrative framing was a bit misleading, compared to where this book would lead after that. But the whole idea of framing her arguments through such a lens gives the essay character, if not much more.
Its almost 100 years of age don't make the book less interesting or relevant – exactly the opposite! A Room of One's Own is quite unique in that it combines the next best thing to a modern perspective on feminism and gender (with certain caveats) with the authentic perspective of an actual early 20th century writer, who is also much more closely linked to the first big female authors of the 19th century and how they were perceived at the time. At times, this feels like an essay written by a time traveler from the late 1960s – which makes the sentences where she gets cautiously excited about female writers 100 more in the future.
I love how poetical this book is for an essay and how it is modest and scathing at the same time. Basically Virginia Woolf's brand, but with clarity that is (intentionally) absent in her novels.
The first chapter that consisted almost solely of narrative framing was a bit misleading, compared to where this book would lead after that. But the whole idea of framing her arguments through such a lens gives the essay character, if not much more.
Its almost 100 years of age don't make the book less interesting or relevant – exactly the opposite! A Room of One's Own is quite unique in that it combines the next best thing to a modern perspective on feminism and gender (with certain caveats) with the authentic perspective of an actual early 20th century writer, who is also much more closely linked to the first big female authors of the 19th century and how they were perceived at the time. At times, this feels like an essay written by a time traveler from the late 1960s – which makes the sentences where she gets cautiously excited about female writers 100 more in the future.
Einer der unterschätzten Klassiker, über die (meiner Erfahrung nach) im Deutschunterricht und sogar im Germanistikstudium selten geredet wird. Vielleicht, weil die Schachnovelle mit ihrem strammen Pacing und klaren Erzählstil beinahe wie ein Pulp-Thriller wirkt. Die Novelle verschwendet keine Sekunde, um ihre kompakte Geschichte zu erzählen. Sprachlich trifft jeder Satz mit bewundernswerter Klarheit auf den Punkt, mit dem lebendigen Ausfallschritt als Akzent zwischendurch. Das thematische Gemisch zwischen Schach, Exilierung, PTSD und Nazifolter ist bis heute so einzigartig wie spannungsgeladen.
Der Vergleich zur jüngsten Verfilmung drängt sich natürlich auf, sofern man den Film gesehen hat. Was mich wunderte, war, dass die Nazis im Original deutlich gediegener erschienen. Das muss jedoch kein Nachteil sein – in einer modernen Popkultur, in der Nazis als das personifizierte Böse gerne überzeichnet werden, bis sie sich der Glaubwürdigkeit entziehen. Die zeitliche Nähe zum Setting macht die Novelle hier möglicherweise authentischer und verleiht dem Ganzen die nötige düstere Schwere, ohne dabei zu schreien.
Der Vergleich zur jüngsten Verfilmung drängt sich natürlich auf, sofern man den Film gesehen hat. Was mich wunderte, war, dass die Nazis im Original deutlich gediegener erschienen. Das muss jedoch kein Nachteil sein – in einer modernen Popkultur, in der Nazis als das personifizierte Böse gerne überzeichnet werden, bis sie sich der Glaubwürdigkeit entziehen. Die zeitliche Nähe zum Setting macht die Novelle hier möglicherweise authentischer und verleiht dem Ganzen die nötige düstere Schwere, ohne dabei zu schreien.
To the Lighthouse takes the proven formula of Mrs Dalloway and puts it into a context in which this introspective approach has way more room to breath. By narrowing the setting from London to only a small summer abode and its immediate vicinity, it becomes even less important (or distracting) what is happening outside the characters' streams of consciousness.
During the first hour or so, I felt utterly lost. It definitely helps to have a list of characters and their most important attributes close at hand. Other than that, there is next to no plot and with that, this novel works way better than it should on paper. How the beautiful prose makes thoughts and emotions feel tangible, almost material, is mesmerizing – even when you lose track at times of which character is in charge right now.
Would it have helped if the author had used the characters' actual names instead of only their pronouns for pages on, after mentioning the name one initial time when passing the focal baton? Sure, it would have. On top of that, even in the rather narrow setting, it's not always clear where the characters are right now, spatially. In the second half, especially, I constantly caught myself wondering "Are they still in a boat? How big is the boat? Are they ALL in that boat? Have they arrived at the lighthouse yet? Huh, it sounds like they're back on some shore!?"
The good thing – and maybe the best thing about this entire novel – is that you can just let go. It isn't even necessarily important who is talking (or thinking) at all times. The prose itself, and the images it creates, are beautiful enough. And every few beats, I felt myself relating to individual thoughts of characters; or I was astounded by their sharp observations and takes on certain kinds of behavior, relationships or their own feelings. The fact that all characters are rather average, some almost dull, makes their perspectives and individual thoughts all the more relatable.
It's amazing how To the Lighthouse fills the inner worlds of these – in the greater context of literature – extremely mundane people with such rich detail and texture. All while tackling its breaking points and disruptions like sudden deaths or the implications of World War I with shaking bluntness – like sharp nails in an evenly planed piece of soft bright wood.
During the first hour or so, I felt utterly lost. It definitely helps to have a list of characters and their most important attributes close at hand. Other than that, there is next to no plot and with that, this novel works way better than it should on paper. How the beautiful prose makes thoughts and emotions feel tangible, almost material, is mesmerizing – even when you lose track at times of which character is in charge right now.
Would it have helped if the author had used the characters' actual names instead of only their pronouns for pages on, after mentioning the name one initial time when passing the focal baton? Sure, it would have. On top of that, even in the rather narrow setting, it's not always clear where the characters are right now, spatially. In the second half, especially, I constantly caught myself wondering "Are they still in a boat? How big is the boat? Are they ALL in that boat? Have they arrived at the lighthouse yet? Huh, it sounds like they're back on some shore!?"
The good thing – and maybe the best thing about this entire novel – is that you can just let go. It isn't even necessarily important who is talking (or thinking) at all times. The prose itself, and the images it creates, are beautiful enough. And every few beats, I felt myself relating to individual thoughts of characters; or I was astounded by their sharp observations and takes on certain kinds of behavior, relationships or their own feelings. The fact that all characters are rather average, some almost dull, makes their perspectives and individual thoughts all the more relatable.
It's amazing how To the Lighthouse fills the inner worlds of these – in the greater context of literature – extremely mundane people with such rich detail and texture. All while tackling its breaking points and disruptions like sudden deaths or the implications of World War I with shaking bluntness – like sharp nails in an evenly planed piece of soft bright wood.
Rarely have I seen a novel stretch so little diegetic time over so many pages... but in a good way! I loved the intricate manner in which the characters perceived their surroundings. What fascinates me about many literary classics, in general, is that they offer us first-hand glimpses into what our world, our culture and social life felt like in a certain time or place.
Of course, the early 1900s aren't ancient history. But still, no film or audio recording can evoke the perceived aesthetic of the time in the same way a good novel can. On an – admittedly stupid – and very subjective level, it's easy to forget that people who lived in the "eras of classic literature" weren't just some faceless mass that appear as "the people" in modern history books, but individuals with rich and complex inner lives as well. Mrs. Dalloway offers a great example of that emotional complexity in average individuals during times before our era of hyper-individualism.
Frankly, halfway through through the novel I gave up caring too much about the minutiae of the social relations between the characters. But the novel works just as well as a slow-rolling wave of words you can just let wash over yourself minute-to-minute .
Of course, the early 1900s aren't ancient history. But still, no film or audio recording can evoke the perceived aesthetic of the time in the same way a good novel can. On an – admittedly stupid – and very subjective level, it's easy to forget that people who lived in the "eras of classic literature" weren't just some faceless mass that appear as "the people" in modern history books, but individuals with rich and complex inner lives as well. Mrs. Dalloway offers a great example of that emotional complexity in average individuals during times before our era of hyper-individualism.
Frankly, halfway through through the novel I gave up caring too much about the minutiae of the social relations between the characters. But the novel works just as well as a slow-rolling wave of words you can just let wash over yourself minute-to-minute .
This novel probably wouldn't work in any other setting. But for a 1950s setting, coded through the lens of a contemporary author, it's enough for a woman to have no chill.
Although it takes her a while to get there. And that is the appeal of this journey with its sharp introspection and psychological tension topped with witty quotes.
For some reason, lines like "There is nothing like puking with somebody to make you into old friends" are much funnier when they hit you from 70 years in the past. This novel is definitely more than its reputation of being bold and prescient, from a feminist perspective – which it also is, of course, and very much so.
Although it takes her a while to get there. And that is the appeal of this journey with its sharp introspection and psychological tension topped with witty quotes.
For some reason, lines like "There is nothing like puking with somebody to make you into old friends" are much funnier when they hit you from 70 years in the past. This novel is definitely more than its reputation of being bold and prescient, from a feminist perspective – which it also is, of course, and very much so.